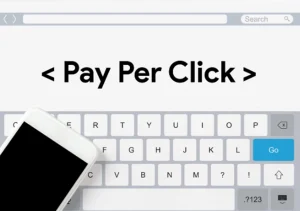Seitenindex
Teilen Sie diesen Artikel:
Fast jedes neue Produkt nennt sich heute «AI-Agent». Das klingt nach Innovation, Zukunft und Autonomie. Doch häufig steckt dahinter lediglich clevere Automatisierung mit hübscher Benutzeroberfläche. Der Unterschied ist mehr als Semantik: Wer Agenten erwartet und Workflows bekommt, verliert Vertrauen – in das Produkt, die Technologie und die Branche.
Für Entscheider wie CEOs, CMOs und Gründer ist es essentiell, zwischen echter Agentik und Automatisierung zu unterscheiden: Nur so lassen sich Investitionen, Erwartungen und Strategien sinnvoll steuern.
Agent oder Automatisierung? – Eine Frage der Substanz, nicht des Marketings
In der KI-Forschung beschreibt ein Agent nicht irgendein Tool, das automatisiert arbeitet. Ein echter AI-Agent ist ein System, das seine Umgebung wahrnimmt, Entscheidungen trifft, auf neue Situationen reagiert und ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Es agiert mit einem gewissen Mass an Autonomie.
Ein Staubsauger Roboter, der selbstständig Hindernisse umgeht und sich auflädt, ist ein Agent. Ein Bot, der vordefinierte Befehle über eine API abspult, ist hingegen automatisiert – aber nicht intelligent.
Viele der Systeme, die heute als «AI-Agent» vermarktet werden, sind in Wirklichkeit raffinierte Automatisierungslösungen. Und das ist keineswegs schlecht – solange es ehrlich benannt wird.
Warum es mehr als nur ein Begriff ist: 4 strategische Gründe für Klarheit
- Erwartungsmanagement: Wird ein Workflow als «Agent» verkauft, steigen die Erwartungen – an Autonomie, Anpassungsfähigkeit und Robustheit. Enttäuschungen sind vorprogrammiert.
- Produktentwicklung: Wer wirklich einen Agenten bauen will, muss Feedback-Mechanismen, Gedächtnisstrukturen und Planungsfähigkeiten einplanen – nicht nur Trigger und Actions.
- Wettbewerbsvorteil: Nur wer eine echte Agentik anbietet, kann sich nachhaltig differenzieren. Wer den Begriff inflationär benutzt, schadet sich und dem Markt.
- Glaubwürdigkeit der Branche: Überhitztes Marketing schwächt das Vertrauen in KI-Anbieter. Besonders Entscheider erwarten mehr als Buzzwords.
Was echte AI-Agenten auszeichnet – und was nicht reicht
Ein echter Agent vereint mehrere Komponenten zu einem adaptiven, zielgerichteten System:
- Wahrnehmung: Sensoren oder digitale Inputs (APIs, Userdaten etc.)
- Zielorientierung: Handlungen erfolgen nicht blind, sondern im Kontext eines Ziels
- Entscheidungslogik: Auswahl zwischen Alternativen auf Basis von Situation und Ziel
- Gedächtnis: Speicherung und Nutzung von Erfahrungen
- Anpassungsfähigkeit: Reaktion auf unerwartete Veränderungen
- Planung: Zerlegung komplexer Aufgaben in Teilziele
- Lernen: Verbesserung durch Feedback (z. B. via Reinforcement Learning)
Diese Merkmale greifen ineinander. Erst wenn ein System mehrere dieser Aspekte integriert, kann man von echter Agentik sprechen.
Teilen Sie diesen Artikel:
Sind Sie mit den Erfolgen ihrer digitalen Kampagnen unzufrieden? Egal ob über Suchmaschinenoptimierung (SEO), bezahlte Werbung, Content Marketing oder Gamification? Wir freuen uns auf einen kostenlosen und unverbindlichen Austausch zu Growth Hacking und digitalem Marketing in einer Kaffeelänge.

Dr. Gero Kühne
Owner
Dr. Gero Kühne
Owner
Die Realität: Orchestrierte Workflows mit Sprachmodellen dominieren
Viele heutige «AI-Agenten» bestehen aus linearen Workflows, orchestriert mit Tools wie Make, Zapier oder n8n, ergänzt durch GPT-basierte Antworten. Sie führen Tasks aus, doch sie:
- verstehen nicht den Kontext,
- können keine Prioritäten setzen,
- und reagieren nicht adaptiv auf Abweichungen.
Sie sind Automatisierungslösungen mit KI-Anstrich – was okay ist. Problematisch wird es, wenn sie als «autonome Agenten» vermarktet werden.
Datenschutz – oft unterschätzt, aber geschäftskritisch
Insbesondere bei Drittanbieter-Plattformen lauern Datenschutzrisiken:
- Speicherung sensibler Daten ausserhalb der Schweiz oder EU
- Intransparente Datenflüsse, die DSGVO oder revDSG unterlaufen
- Erhöhte Angriffsflächen durch externe Infrastrukturen
- Unklare Haftung bei Vorfällen
Entscheider müssen bei AI-Agent-Projekten frühzeitig Datenschutz- und Compliance-Strategien einbeziehen. Nur so lassen sich Vertrauen und Skalierbarkeit verbinden.
Fazit
Nicht jedes automatisierte System ist ein AI-Agent – und das ist völlig legitim. Doch wenn jede Workflow-Automatisierung plötzlich als „Agent“ vermarktet wird, verliert der Begriff an Bedeutung und Glaubwürdigkeit.
Echte AI-Agenten sind mehr als GPT mit Triggern – sie denken voraus, handeln kontextsensitiv und lernen kontinuierlich dazu.
Eine präzise Sprache schafft Mehrwert für alle:
- Anwender wissen, was sie erwartet – und was nicht.
- Entwicklungsteams können realistisch planen und priorisieren.
- Marketing & Sales vermeiden überhöhte Versprechen – und gewinnen Vertrauen.
- Die Branche stärkt ihre Reife und Differenzierungsfähigkeit.
Auch wir bei Lean & Sharp setzen auf diese Klarheit. In Kürze werden wir erste Automatisierungen und echte Agentenlösungen bereitstellen – immer mit Fokus auf Transparenz, Sicherheit und skalierbarem Mehrwert für Unternehmen.
Ob Automatisierung oder Agentik: Entscheidend ist nicht das Label, sondern der Nutzen, den das System im realen Einsatz stiftet.
Wenn Sie mit echten KI-Lösungen arbeiten wollen – funktional, rechtssicher und marktwirksam –, stehen wir gerne als Sparringspartner zur Verfügung.
Teilen Sie diesen Artikel:
FAQs
Ein echter AI-Agent agiert mit einem gewissen Mass an Autonomie, nimmt seine Umgebung wahr, trifft kontextbasierte Entscheidungen und passt sich neuen Situationen an. Automatisierung hingegen folgt festen Regeln und arbeitet ohne eigenes Verständnis oder Lernfähigkeit.
Fortschrittliche AI-Agenten können aus Feedback lernen, Aufgaben in Teilziele aufteilen und ihr Verhalten optimieren. Viele derzeitige Systeme sind jedoch noch begrenzt – sie reagieren hauptsächlich und verfügen weder über echtes Langzeitgedächtnis noch über strategische Planung.
Falsche Begriffe erzeugen überzogene Erwartungen und führen zu Enttäuschungen, wenn Systeme nicht autonom handeln. Zudem wird der Begriff des echten Agenten entwertet – das schwächt die Glaubwürdigkeit der Branche.
Echte Agenten werden in Bereichen wie intelligente virtuelle Assistenten, Kundenservice, adaptive Prozessautomatisierung, automatisierte Recherche oder Robotik eingesetzt – überall dort, wo kontextabhängige Entscheidungen und Lernfähigkeit gefragt sind.
Typische Merkmale echter Agenten:
- Autonomie und Eigeninitiative
- Wahrnehmung von Umgebung und Eingaben
- Zielgerichtetes Verhalten
- Entscheidungsfähigkeit
- Anpassungsfähigkeit an neue Situationen
- Gedächtnis oder Zustandsbewusstsein
Lernfähigkeit über Zeit hinweg
Solche Drittanbieter-Plattformen bringen Datenschutz- und Compliance-Risiken mit sich:
- Daten können ausserhalb der Schweiz oder EU gespeichert/verarbeitet werden
- Intransparente Datenflüsse erschweren DSGVO- oder revDSG-Konformität
- Externe Infrastrukturen erhöhen das Risiko für Datenlecks und Angriffe
- Die Haftung bei Vorfällen ist oft unklar – vertragliche Regelungen sind essenziell
- Datenübertragungen in Drittländer erfordern zusätzliche Sicherheiten
Geringe Kontrolle über die Datenverarbeitung macht eine sorgfältige Tool-Auswahl und Risikobewertung unerlässlich